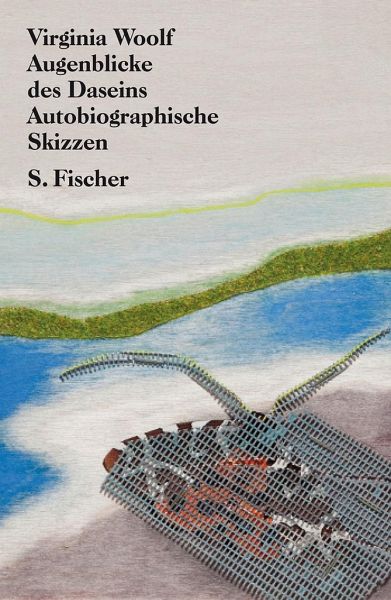»Tatsächlich denke ich manchmal, dass nur die Autobiographie wirkliche Literatur ist; Romane sind Schalen, die wir entfernen, um schließlich im Innersten anzukommen«, schrieb Virginia Woolf in einem Brief an den Schriftstellerkollegen Hugh Walpole. Neben den etwa 4000 Briefen und den Tagebüchern, in denen sie Auskunft über sich selbst erteilt, die jedoch von einer Scheu geprägt sind, die traumatischen Erlebnisse, von denen es in ihrem Leben mehr als genug gab, zu analysieren, ja oft, sie nur zu benennen, hat Virginia Woolf mit ihren Romanen, Erzählungen und Essays zwar große Literatur geschrieben, aber keine Autobiographie.
Im Nachlass fanden sich lediglich zwei autobiographische Fragmente, die 1907 geschriebenen »Reminiszenzen« sowie die 1939/40 entstandene »Skizze der Vergangenheit« – beide wurden 1976 von Jeanne Schulkind ediert und sind 1981 zum ersten Mal auch auf Deutsch erschienen. Im Rahmen seiner nicht genug zu rühmenden Woolf-Werkausgabe hat Klaus Reichert sie jetzt, in neuer Übersetzung von Brigitte Walitzek und wie alle Bände vorzüglich kommentiert, unter dem Titel »Augenblicke des Daseins« herausgegeben, zusammen mit drei Vorträgen, die Woolf vor dem 1920 gegründeten Memoir Club hielt, der die alten Freunde aus Bloomsbury, die durch den Krieg zerstreut worden waren, wieder versammelte. Die beiden Fragmente spannen einen Bogen vom Beginn der schriftstellerischen Laufbahn Woolfs bis kurz vor ihren Tod, geben daher nicht nur eine Erzählung der Lebensgeschichte, sondern sind, in Stil und Form, auch Zeugnis ihrer schriftstellerischen Entwicklung.
Als Virginia Woolf (damals noch unverheiratet und also Virginia Stephen) die »Reminiszenzen« schrieb, war sie 25 Jahre alt. Sie hatte bereits einige kurze Essays veröffentlicht und arbeitete an ihrem ersten Roman, »The Voyage out« (Die Fahrt hinaus), der schließlich 1915 erschien. Anlass für die »Reminiszenzen« war die erste Schwangerschaft ihrer drei Jahre älteren, innig geliebten Schwester Vanessa, die gerade den Kunstkritiker Clive Bell geheiratet hatte. Virginia reagierte auf die Verbindung mit heftiger Eifersucht und unternahm einen ersten Selbstmordversuch. Dass sie dann, während der gemeinsam an der Südküste von Sussex, wenn auch nicht im selben Ort, verbrachten Sommerferien, für das noch ungeborene Kind ein Porträt der werdenden Mutter schreibt, lässt sich da durchaus als selbsttherapeutischer Stabilisierungsversuch deuten, in dem es um die Klärung des Verhältnisses zur Schwester und die Wiedergewinnung von Autonomie geht – noch mehr als eine Erzählung des Werdens der Schwester sind die „Reminiszenzen« eine des eigenen Gewordenseins.
Denn schon nach wenigen Sätzen gerät der ursprüngliche Schreibimpuls, das Seelenleben der Kindheits-Schwester zu ergründen und ihre Entwicklung zu beschreiben, zu einer Erzählung der Vergangenheit, in deren Mittelpunkt die Mutter, Julia Stephen, steht. Sie war das Herz der Familie, ihr früher Tod im Alter von 49 Jahren, beendete die, jedenfalls im Rückblick, als idyllisch empfundene Kindheitswelt mit einem Schlag und löste bei der damals 13-jährigen Virginia einen ersten schweren Nervenzusammenbruch aus. Das lange Verweilen bei den Veränderungen, die danach im Familienleben eintraten, mutet da an wie eine Verlagerung der augenblicklichen Krise, die ähnliche Verlustängste, jetzt auf die Schwester bezogen, ausgelöst hat.
Der damalige Nervenzusammenbruch bleibt in den Erinnerungen freilich ebenso unerwähnt wie sich der gerade stattgefundene Suizidversuch in ihnen niederschlägt. Wie in den Briefen und Tagebüchern spart Woolf auch in den autobiographischen Schriften ihre psychischen Krisen fast vollständig aus: ihre regelmäßig wiederkehrende Panik vor jeder Veröffentlichung eines neuen Werks wird höchstens angedeutet, von ihrem problematischen Verhältnis zur eigenen Sexualität ist nicht die Rede, und vom Zusammenleben mit ihrem Mann Leonard Woolf erfährt man nur die Fakten, nichts jedoch von Spannungen, Streit, unerfüllten Wünschen und virulenten Ängsten.
Mag das Verschweigen der eigenen psychischen Gefährdung in der Kindheit für die »Reminiszenzen« noch einigermaßen plausibel sein, sind diese doch vorgeblich eine Verbeugung vor Vanessa und an ein (ungeborenes) Kind gerichtet, so fällt deren Nichterwähnung in der mehr als dreißig Jahre später begonnenen »Skizze der Vergangenheit« überdeutlich ins Auge.
Auch hier diente die Schwester als Motivatorin, allerdings weit direkter. »Schreib deine Memoiren, ehe du zu alt bist und alles vergessen hast«, hatte Vanessa zu ihr gesagt. Und Woolf nimmt die Aufforderung sofort an, froh darüber, die mehr und mehr als Last empfundene Arbeit an der Biographie ihres Freundes und Mentors, des Kunstvermittlers und Begründers der Omega-Werkstätten Roger Fry, der 1934 gestorben war, unterbrechen zu können.
Sie ist jetzt fast sechzig, eine berühmte Schriftstellerin, die sich ihrer künstlerischen Mittel vollkommen bewusst ist. Und ihr Schreiben, gerade auch ihr autobiographisches, mit dem Wissen um das bereits Geschriebene, ganz anders angeht und reflektiert. Ihre gesammelten Erfahrungen als Romanschriftstellerin, Essayistin, fließen ebenso ein wie die der begeisterten Leserin von (Auto-)Biographien – die sie allerdings fast immer enttäuschten, und zwar aus einem Grund, den sie gleich zu Beginn ihrer »Skizze« benennt: »Hier stoße ich auf eine der Schwierigkeiten des Memoirenschreibers – einen der Gründe dafür, daß von so vielen Memoiren, die ich lese, so viele mißlungen sind. Sie lassen die Person aus, der die Dinge geschahen. Der Grund dafür ist, daß es so schwierig ist, einen Menschen zu beschreiben. Also sagen sie: ‚Folgendes geschah‘; aber sie sagen nicht, wie der Mensch war, dem es geschah. Und die Geschehnisse bedeuten sehr wenig, solange wir nicht zuerst wissen, wem sie geschahen. Wer also war ich?«
Fakten sind wichtig, bleiben aber etwas Äußerliches, wenn man nicht ihrer Wirkung nachgeht. Gerade Ereignisse, die für andere wenig Bedeutung haben, können für ein ganzes Leben bestimmend sein, Quell der künstlerischen Produktivität. So ist es mit Woolfs frühesten Kindheitserinnerungen – in den Ekstasen, die sie auf dem Schoß der Mutter sitzend erfahren hat, oder im Kindheitssommerhaus in St. Ives, als sie am Abend in ihrem Bett lag, auf der Schwelle zwischen Wachsein und Schlaf, und das Licht durch ein heruntergezogenes Rollo fallen sah, dazu das leise Geräusch der Wellen hörte – in diesen ersten starken Eindrücken schwingt schon etwas mit von ihrem späteren Stil, der aus der Montage von Impressionen, Gedanken, Wünschen, Erinnerungen, Träumen, Realitätsfetzen nach und nach eine Erzählung, einen Roman baut. Und ebenso ist es mit den »Schocks«: die Lähmung, die sie überkommt, als sie zu einem Fausthieb gegen ihren Bruder Thoby ausholt oder vom Selbstmord eines Nachbarn erfährt, prägt sich ihr tief ein.
Diese »Schocks« sind, wie die positiven »Ekstasen«, Augenblicke einer jähen Wahrnehmungs- und Daseinserfahrung, von Woolf moments of being genannt, die „eingebettet (sind) in viel zahlreichere Augenblicke des Nicht-Seins (non-being)«. Sie lassen, schreibt Woolf, »etwas Reales hinter dem Schein« sehen, »eine Art Offenbarung«, die nach Klärung, Erklärung durch das Schreiben verlangt. »Ich habe das Gefühl, einen Schlag erhalten zu haben; aber es ist, anders als ich als Kind dachte, nicht einfach nur ein Schlag von einem Feind, der sich hinter der Watte des täglichen Lebens versteckt; es ist eine Art Offenbarung, oder wird zu einer werden; es ist ein Zeichen für etwas Reales hinter dem Schein; und ich mache es real, indem ich es in Worte fasse. Erst indem ich die Erfahrung in Worte fasse, mache ich sie zu etwas Ganzem; diese Ganzheit bedeutet, daß sie die Macht verloren hat, mir weh zu tun (...)«.
Damit hat sie den Kern nicht nur ihres autobiographischen Schreibens, sondern ihres Schreibens überhaupt benannt: Kontroll- und Autonomiegewinn. Beides gelingt nur durch die Herstellung einer Distanz zur Welt und zu sich selbst – als derjenigen, der das, wovon sie erzählt, widerfahren ist, und der, die sich, während dieses Erzählens, beobachtet, denn nur so kann sie es formen. Beim Memoirenschreiben, von Woolf »life writing« genannt, ein Begriff, der das Prozessuale, Unabgeschlossene betont, verstärkt sich noch einmal die Teilung in zwei Ichs. Es befinden sich nicht nur das schöpferische, sich dem kreativen Prozess hingebende Ich und das diesen Prozess kontrollierende in permanentem Austausch, sie sind zudem vervielfacht – in erinnerter und erinnernder Zeit. Woolf wechselt in der »Skizze« nicht nur zwischen den Perspektiven »ich jetzt, ich damals« hin und her; das Wechselverhältnis von vergangenen Ichs und dem gegenwärtigen (das wiederum sogleich zu einem vergangenen wird) ist auch erst Auslöser für bestimmte Erinnerungen, motiviert die Auswahl, durchbricht die Erzählchronologie, wird mehr und mehr zum Strukturmerkmal, wenn nicht eigentlichem Thema des Textes.
Sowohl die »Reminiszenzen« als auch die »Skizze der Vergangenheit« behandeln denselben Stoff: die Herkunft, die Familie, die Rolle von Vater, Mutter, Geschwistern, (früheste) Kindheitserinnerungen. Aber zwischen beiden autobiographischen Fragmenten liegt ein reiches, schmerzliches Schriftstellerinnenleben, so dass zwei ganz verschiedene Texte entstanden sind. Die Lektüre lohnt sich daher aus (mindestens) zwei Gründen: Man erfährt etwas über das Leben Virginia Woolfs, und zwar wie sie es selbst gesehen hat und gesehen haben wollte. Denn natürlich inszeniert sie sich in ihren Erinnerungen, trennt das, was von ihr im Gedächtnis bleiben soll, von dem, was sie des Vergessens für wert befindet. Die großen Traumata bleiben unerwähnt: das Erwachen der eigenen Sexualität und ihr Verdrängen, die Rationalisierung und Sublimierung des Begehrt-Werdens und Begehrens, die psychischen Krisen, die (Auto-)Aggression. Die Strategie der Schock-Bewältigung scheint, was das autobiographische Schreiben angeht, nicht zu genügen, die Scham zu groß. Sie tauchen, angedeutet, verwandelt, fiktionalisiert, in den Erzählungen und Romanen auf.
Aber gerade die Leerstellen geben zu erkennen. Sie verweisen auf den zentralen Punkt einer jeden Schriftsteller-, Künstlerbiographie: die zweite Geburt, die durch Selbsterfindung im künstlerischen Akt erfolgt. In Woolfs »Autobiographischen Skizzen« kann man dieser Verwandlung eines Lebens in Literatur beiwohnen, erkennt, welchen Schwierigkeiten man bei diesem Versuch begegnet, wie man mit ihnen umgehen kann, begreift also, was es heißt zu schreiben, eine Schriftstellerin zu sein, eine, die unablässig darum bemüht war, sich ihrer selbst zu vergewissern, ihres Intellekts, ihrer Empfindungen, sich zu erforschen und zu bilden, darin nie nachlässig zu werden, sondern sich das Höchste abzufordern: Aufrichtigkeit. Und sich das Schönste zu erkämpfen, was ein Mensch sich geben kann: die freie Entfaltung der in ihm angelegten Fähigkeiten.
Virginia Woolf: »Augenblicke des Daseins (Moments of being). Autobiographische Skizzen«. Deutsch von Brigitte Walitzek. S. Fischer 2012, 272 Seiten, 26 Euro
fixpoetry, 15. Juni 2013