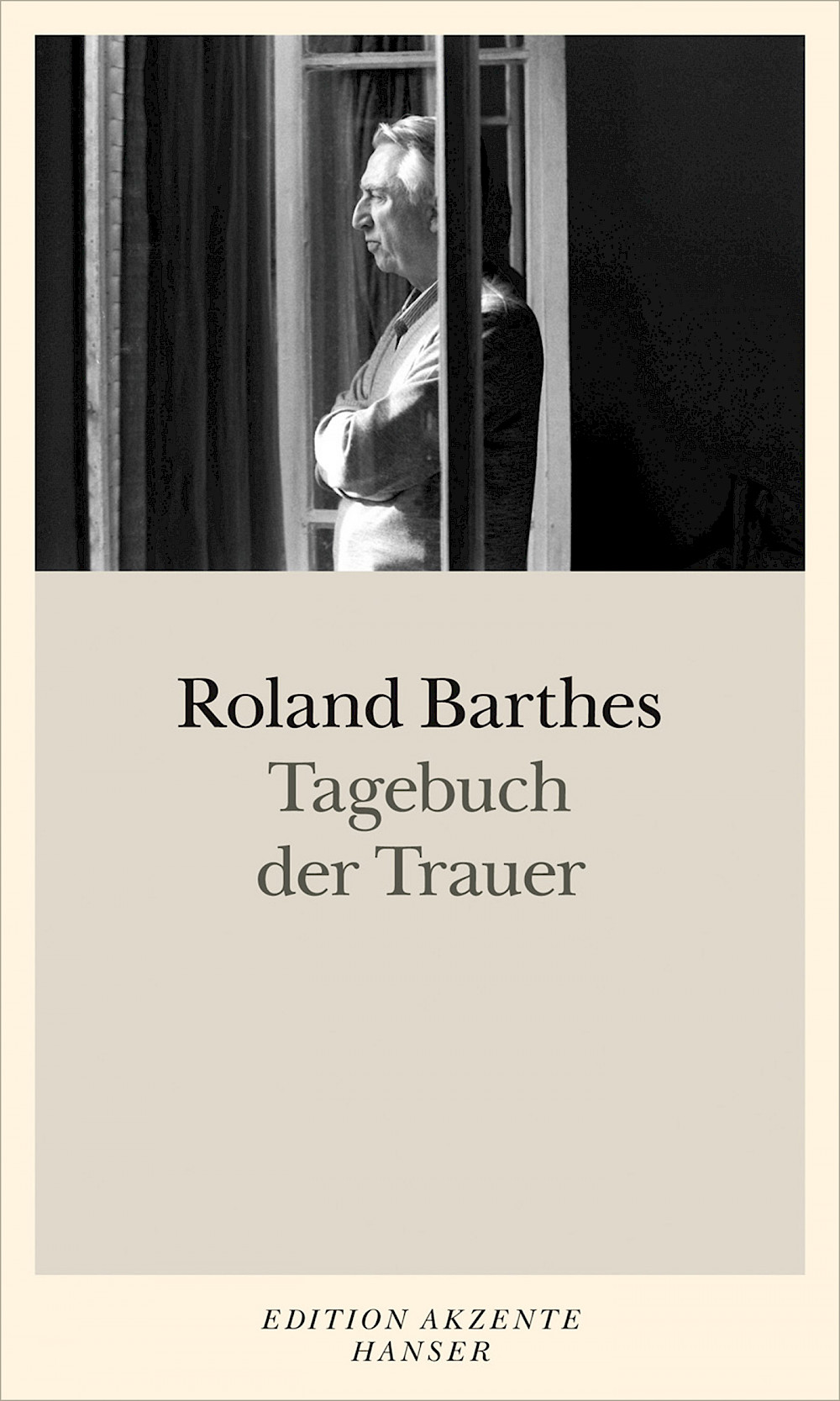»Am 25. Oktober 1977 trifft Roland Barthes das größte Unglück: Seine 84-jährige Mutter stirbt. Das ganze Leben hatte er, von kurzen Reisen abgesehen, mit ihr unter einem Dach gelebt, sie war immer um ihn, hatte den Sohn, bei dem 1934 eine Tuberkulose diagnostiziert worden war und der Jahre seines Lebens in Sanatorien verbringen musste, umhegt. Nun hatten sie die Rollen getauscht: ›[Rollenverwirrung.] Monatelang war ich ihre Mutter. Es ist, als ob ich meine Tochter verloren hätte‹, schreibt er in dem einen Tag nach ihrem Tod begonnenen ›Tagebuch der Trauer‹, das nun, ein Jahr nach seinem Erscheinen in Barthes’ französischem Verlag Seuil, bereits auf Deutsch vorliegt. Auf kleinen Zetteln, von denen immer ein Stapel auf seinem Schreibtisch liegt, notierte Barthes, sich selbst beobachtend, die Wandlungen seines Schmerzes, dessen An- und Abschwellen und seine Wiederkehr, aber auch seine Fluchtversuche, wechselnden Stimmungen, seine Lügen und kleinen Freuden, die er trotz des ›Kummers‹, wie er, Proust zitierend, seine Trauer nennt, erlebt.
Proust, der Autor der ›Recherche‹, war immer schon eine Bezugskonstante bei Barthes, nun aber, in der Trauer, nimmt Barthes’ Proust-Liebe und -Identifikation, geradezu den Charakter einer Nachfolge an. Am 4. November, zehn Tage nach dem Tod der Mutter, taucht Prousts Name das erste Mal auf einem der Zettel auf; in der Folge richtet Barthes sein Schreiben ganz explizit an diesem Vorbild aus. Den Ansatzpunkt der Identifikation bildet dabei das ›Begehren zu schreiben‹, wie es für ihn wie nirgendwo sonst im proustschen Romanwerk zum Ausdruck kommt, dieser Verbindung von Essay und Roman – der ›dritten Form‹, zu der Proust erst nach dem Tod seiner Mutter gefunden hat.
Nach eben einer solchen Verbindung, die es erlaubt, „im Angesicht des Allgemeinen, der Wissenschaft‹ das Intime zum Sprechen zu bringen, sucht auch Barthes. Rein äußerlich verändert sich in seinem Leben wenig: Nach der Beerdigung in Urt, dem Herkunftsdorf und Ort ländlicher (Schreib-)Aufenthalte, kehrt Barthes an den Pariser Schreibtisch zurück, bereitet seine Vorlesungen vor, schreibt Artikel. ›Trauer, Depression, Arbeit etc. – aber diskret, wie gewohnt‹, notiert er. Den Freunden erscheint er ruhig, denn seine Trauer „liegt nicht geradewegs in der Einsamkeit, im Empirischen etc.; ich habe da eine Art Leichtigkeit, Beherrschung, die die Leute glauben läßt, ich hätte weniger Kummer, als sie dachten. Sie liegt dort, wo die Liebesbeziehung zerreißt, das ‚Wir haben uns geliebt‘.‹
Diese Trauer vergeht nicht, sie ist wie eine Krankheit, sklerotisch, und er spürt, je länger sie dauert, das ›Verlangen, (...) meinen Kummer in ein Schreiben einzubauen‹. Sein Begehren kreist um ein Buch, er hat schon den ›Tag vor Augen, an dem ich endlich werde schreiben können‹, das ›Vita nova‹ genannte Romanprojekt, zu dem er Skizzen macht und aus dem dann die Vorlesung ›Die Vorbereitung des Romans‹ wird – nicht der ersehnte Roman, denn: ›Wahre Trauer ist zu irgendeiner narrativen Dialektik außerstande‹.
Oder doch? Nach Monaten, beim erstmaligen Wiederbetrachten von Fotografien, findet Barthes eine Aufnahme, die seine Mutter ›als kleines Mädchen zeigt, zart, scheu‹ – er ist ›überwältigt‹, weint. Angst erfasst ihn, ›eine Arbeit in Angriff zu nehmen, die von diesen Photos ausgeht‹, hat er doch das Gefühl, ›daß die eigentliche Trauer jetzt erst beginnt‹. Doch dieses Foto bildet den Fixpunkt der zweiten Hälfte des Tagebuchs wie auch das leere Zentrum der ›Hellen Kammer‹, seiner ›Bemerkung zur Photographie‹, die parallel entsteht – dieses Buch über Präsenz und Abwesenheit, über den Tod, über die ›Unfähigkeit der Fotografie‹ ›das Offensichtliche auszusagen. Geburt der Literatur‹. Dieses Buch wird sein Roman, so anders als geplant und dennoch die Voraussetzung erfüllend, unter die Barthes sein Schreiben gestellt sieht – versteht er doch darunter ›jegliche Form, die gegenüber meiner früheren Praxis, meinem früheren Diskurs neu ist‹ – und neu in der Form ist dieses Buch, das um die Mutter kreist und in dem er ihr ein Denkmal errichten will, um zu verhindern, dass sie, wenn er eines Tages gleichfalls tot sein wird, nicht mit seinen Erinnerungen verschwindet, und das doch so viel mehr ist als ein Gedenkstein, eine Erinnerungstafel – nämlich das Zeugnis seiner Trauer um ihren Tod, die andere Seite des ›Tagebuchs‹ also, das dann, als er immer mehr ins ersehnte, begehrte Schreiben, in den ›Übergang des Kummers auf die Seite der Aktiva‹ kommt, abbricht, da die Trauer ›vollendet‹ ist, ›im und durch das Schreiben‹.«
Literaturen, März 2010